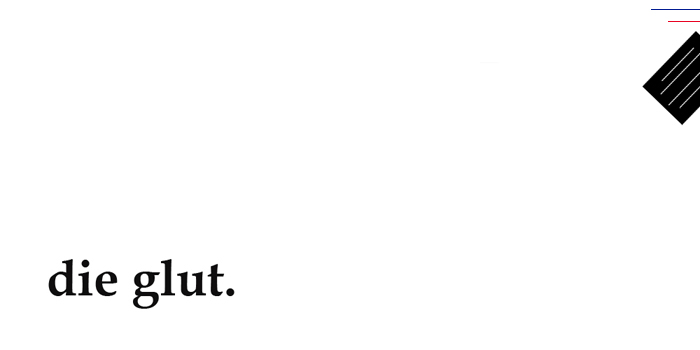Samstag, 24. Dezember 2011
Dienstag, 20. Dezember 2011
Freitag, 16. Dezember 2011
Gottschalk live.
„Gute Nacht,
es war eine tolle Zeit, auf Wiedersehen.“
Thomas
Gottschalks Abschiedsworte klangen so unprätentiös wie der gesamte Abend seiner
letzten „Wetten, dass?“ Sendung. Ohne großes Überraschungsmoment plätscherte
die Show ihrem Ende entgegen. Spannungsbogen Fehlanzeige. In Erinnerung bleiben
der funkelnd kitschige Abschiedsbanner sowie Andrea Kiewels Tränen, die sie in
Gedanken an einen historischen Abschied nicht zurückhalten konnte. Tränen, die dem ZDF dank eines schaurig
schönen Marktanteils von 46% bitter über die Wange rollen.
Man könnte das
Format von „Wetten, dass?“ als
redundanten Unterhaltungstrash bezeichnen. Redundanter Unterhaltungstrash, der
nicht sein muss, aber ist, weil er sich seit langem bewährt.
Der zeitweise
kurzweilig atmet und des Henkers kalte Schlinge im Nacken spürt.
„Wetten,
dass?“ ist dessen gelebte Verkörperung. Traditionelle Geschlechterverhältnisse
und stereotype Attributisierungen treffen auf Justin Bieber &Co. Plakathochhaltende
Groupies gesellen sich zu feinzwirniegen Altherrenbünden. Das ist insofern
redundante Unterhaltung als RTL und Co ähnliche Formate senden und der
Zuschauer bereits nach mehr als einer Stunde merkt, dass er nach musikalischer
(Meatloaf-Medley) wie verbaler Beschallung (Couchtalking) in einen somnambulen
Geisteszustand verfällt. Vom Trashbegriff einmal abgesehen.
Die Qualität
einer auf Massenkompatibilität ausgerichteten Sendung hängt zu einem großen
Teil von ihrem Moderator ab. Thomas Gottschalks Beliebtheit war das Ergebnis
einer ironisch-frechen Art, die ihm – nicht zuletzt aufgrund seiner Optik - einen
Wiedererkennungswert verschaffte. Umso einleuchtender ist es, dass das ZDF Hape
Kerkeling als Gottschalk Nachfolger anheuern wollte. Gilt Kerkeling doch als
Publikumsmagnet, der einen Zuschauersaal spielerisch in die Hand nehmen kann. Günter
Jauchs Selbsteinbringung in die Moderatorendiskussion kann man da schon als süffisante
Anspielung auf das ZDF bezeichnen. Denn das Zweite Deutsche Fernsehen krebst
seit Wochen durch die Moderatorenlandschaft um einen geeigneten
Gottschalknachfolger zu finden. Status bis heute: Moderator = Unbekannt.
Der Abschied
ist für das ZDF weitaus folgenreicher als für Thomas Gottschalk.
Ab dem 23.
Januar sendet er für die ARD „Gottschalk live“, eine 30-minütige Show, die den
Vorabend der ARD aus dem Quotentief holen soll. Ein Format zwischen dem
FAZ-Feuilleton und Bauer sucht Frau strebe er an. An Erregung mangele es bei
den Öffentlich-Rechtlichen, so Gottschalk. Deswegen könne er sich eine
Mischung aus spätem Frühstücksfernsehen
und vorgezogener Late Night vorstellen. Präzise ist das nicht. Aber ich freue
mich auf 25 Minuten Gottschalk. Und vielleicht gesellen sich Klaas und Kompagnon
einmal die Woche dazu. Das wäre ein deutlicher Mehrwert, den die ZDF in puncto
„Wetten, dass?“ nicht mehr besitzt.
Montag, 12. Dezember 2011
Sonntag, 11. Dezember 2011
Die vieltalker ARD.
Wenn ich am
späten Sonntag durch den zuckenden Tatort-Abspann aufgerüttelt werde, ertönt in
meinem Kopf die Stimme meiner Oma. „Die Christiansen, die kannste dir anschauen“,
sagte sie einmal zu mir. Hätte sie gewusst, dass seit diesem Herbst im
öffentlich-rechtlichen Rundfunk nahezu jeden Abend politisch getalkt wird, wäre
sie ungläubig mit dem Kommentar: „Und wer schaut sich das an?“ aus dem Raum
gegangen.
Günter Jauch
verzeichnete bei seiner ersten Sendung 5,1 Millionen Zuschauer. Anne Will, die sonntags
im Durchschnitt 4 Millionen Menschen vor den Fernseher lockte, muss sich fortan
mit dem weniger attraktiven Sendeplatz am Mittwochabend begnügen.
Nebst Jauch
und Will tummeln sich Plasberg, Maischberger und Beckmann im Talkprogramm der
ARD. Kritische Stimmen fragten bereit unmittelbar nach der Bekanntgabe des
Konzepts, wie die Gästeattraktivität aufrecht erhalten werden solle. Schließlich
bewandern Hans-Ulrich Jörges, Klaus Kocks oder Richard-David Precht regelmäßig die
Gehwege der Talkshowrunden. Kocks gab im
Tagesspiegel just lakonisch zu, er wäre bereits so häufig in Talkshows gewesen,
dass die Gäste das Gefühl bekämen, er
sei einfach sitzengeblieben. Ein Koordinationsbüro der ARD übernimmt nun die
Aufgabe, für Ausgewogenheit der Gäste zu sorgen. Schließlich geht es nicht
darum, intern Reibereien qua Gästeunstimmigkeiten auszulösen, nur weil die ARD
Programmdirektoren eine einheitliche Sendezeit der Tagesthemen anstrebten und
somit den Talkrhythmus neu zusammenwürfelten.
Sandra
Maischberger sagte zu Peter Kümmel in der ZEIT, die Diskussionsrunden seien in
einer Mitte angekommen. Eine Mitte, in der Inszenierung, Dramaturgie und Kalkül
der Teilnehmer mehr gewichten als die eigentliche Zielsetzung des
Erkenntnisgewinns für den Zuschauer.
In ihr herrscht
Homogenität. Quotenfixierung. Und eine sonderbare Melange aus Phrasen, Behäbig-
und interessengeleiteter Eitelkeit.
Diskussionsteilnehmer
machen es den Moderatoren schwer, erquickende und spontane Momente aus den
Beteiligten heraus zu kitzeln. Wenn Politiker sprechen, weiß man: Es gibt mehr
Unausgesprochenes als Gesprochenes. Und wenn Gysi eingeladen wird, spürt der
Zuschauer: Er ist der Hebel, der den Kauderwelsch aufbrechen soll.
Wie im
Printbereich verzeichnet sich in den Shows die Tendenz, einen Titel mit Nutzwert
für den Rezipienten zu generieren. Jauch
thematisiert „Generation doof“, Plasberg fragt: „Gehören Pummel an den Pranger?“,
Will sinnt über „Internet-Mobbing“ und Maischberger diskutiert „Ticks, Panik,
Phobien“. Je emotionaler das Thema, desto eher der Identifikationsgrad. Und
desto eher die Chance, dass der Zuschauer einschaltet. Der Gefahr, dass sich
die Talkshowrunden in ein homogenes Feld einbetten, eingeschlossen.
Wie sehr
wünscht man sich in diesem Gewühl aus Talkshowbrei Querdenker und konstruktive Querulanten?
Diskutierende Intellektuelle in einer intimen Runde. Dieses kaum greifbare
Gefühl einer schöpferischen Runde.
Es stellen
sich allerlei Fragen: Verschreckt die
Anzahl der Talkangebote den Zuschauer? Vermindert jene die Qualität des
politischen Talks? Wie wirkt der Grundversorgungsauftrag der ARD ein? Und welches Talkshowformat ist kompatibel
mit Massenmedien?
Wenn ich
nach der Theorie meiner Oma gehen würde, wäre der Sonntagabend ohne meine
Beteiligung. Und doch ertappe ich mich dabei, nach dem Tatort zumindest die Vorstellung
der Talkgäste abzuwarten. Denn wie sagte Goethe: „Der Widerspruch ist es, der
uns produktiv macht.“
Mittwoch, 7. Dezember 2011
Die SPD und der Leitwolf.
Man erinnert
sich mit einem Schmunzeln an Peer Steinbrücks und Helmut Schmidts Auftritt bei
Günter Jauch. Wie Vater und Sohn, Mentor und Schüler saßen sie im Sessel und
gaben bereitwillig Expertise über die Zukunft Europas. Ihre Statements wogen
sich nicht nur im Konsens, sondern schmeichelten darüber hinaus zugleich der politischen
Inszenierung bei einer Reichweite von
5,6 Millionen Zuschauern.
„Er kann
es“, sagte Schmidt nonchalant zu einer möglichen Kanzlerkandidatur Steinbrücks.
Nicht nur im Studio, sondern ebenso im literarischen Gemeinschaftsprojekt „Zug
um Zug“. Und so schwang sich Peer Steinbrück in die bunte Debatte des
Kanzlerschaftskandidaten der SPD für die Bundestagswahl 2013. Per Schützenhilfe
vom Altkanzler und SDPer Urgestein.
Dass
Steinbrück nicht alleine schwingt, wird abseits seiner PR-Klüngelei deutlich.
Sigmar Gabriel und Frank-Walter Steinmeier gelten als Mitstreiter der
Kanzlerfrage. Sie heizen die Diskussion um die Vorreiterrolle bei den
Sozialdemokraten an.
Dem
Pragmatiker Steinbrück kommen die Konservativen zugute. Mit seiner beharrlich
wirtschaftlichen Kursrichtung, die unter anderem eine Reichensteuer ablehnt,
wärmt Steinbrück die Herzen des konservativen Lagers in der SPD. Die Linken
wird er nur schwer auf seine Seite ziehen können. Die SPD müsse
„Regierungsfähigkeit demonstrieren“, so Steinbrück. Ein allzu linkes
Grundsatzprogramm sei demzufolge nicht tragbar. Für beide Seiten stehe die SPD.
Nicht nur für eine.
Tief ist die
Spaltung innerhalb der Partei über die Kanzlerfrage. Der zurückliegende
Parteitag verdeutlicht nicht nur die Unsicherheit, sondern vor allem das
Taktieren im politischen Gefilde.
Es wurde
gesprochen, gewählt und debattiert. Erst Steinmeier, dann Gabriel und
schließlich Steinbrück. Für letzteren gab es respektvollen Applaus. Für den
zweiten Jubel. Denn im Gegensatz zu Steinbrück schafft es Gabriel durch seine
emotionale Rhetorik, Saal und Delegierte mitzureißen.
In
Anknüpfung zu den 91,6 Prozent, die ihm die Wiederwahl zum Parteichef ebneten.
Es bleibt
also abzuwarten, wann die SPD ihrer Diplomatenrolle verlässt.
An klugen
Köpfen mangelt es der SPD nicht. Ebenso wenig an Diskussionsstoff. Das einzige,
das den Sozialdemokraten noch nicht wie Gras aus dem Boden sprießt, ist ein Leitwolf.
Ob dieser an
Zahlen festgemacht werden soll, bleibt anzweifelbar.
Denn wenn es
nach diesen ginge, hätte Hannelore Kraft beste Chancen als Kanzlerkandidatin
ins Rennen zu gehen.
Montag, 5. Dezember 2011
Wöchentliches Glutlicht.
Die Parteien tagen. Mal in Kiel, in Berlin oder Offenbach.
Dann sitzen sie, eingequetscht in einer der parteipolitischen
Programmatik zugeschnittenen Kluft, Mitglied an Mitglied, und reden,
diskutieren, votieren.
Die SPD vor purpurn-roter Fassade, die Grünen vor einer minz-grünen
Wand und die CDU vor dunkelblauen, die Piraten vor schwarzen Vorhängen.
Parteitage sind Großveranstaltungen mit ausgewählten Delegierten,
die parteiliche Grundsätze herausarbeiten und beschließen sowie personalpolitisch
entscheiden. Sie zentrieren Schlüsselthemen und stärken die parteipolitische
Identität.
Es geht um Spitzensteuersätze, Umweltideen, Finanzkriese, Betreuungsgeld
– häufig einhergehend mit Seitenhieben und Lagerdifferenzen.
Während SPD, Grüne und CDU einen Parteitag unter medialer
Beobachtung gewöhnt sind, wägt sich die Piratenpartei medial in neuem Terrain. Über
200 Journalisten akkreditierten sich für den in Offenbach stattfindenden
Parteitag.
In diesem sprachen sich die 1300 Anwesenden mit einer
Zweidrittelmehrheit für ein bedingungsloses Grundeinkommen aus; in einer rege
geführten Diskussion. Damit ergänzten sie ihr Grundsatzprogramm und stellten
weitere Weichen, um bei der Bundestagswahl 2013 Angreifen zu können. Denn die
Partei sei, so konstatierte der Bundesvorsitzende Sebastian Nerz, keine „Eintagsfliege.“
Es ist das Unverbrauchte, Authentische, Basisnahe, das u.a. den Weg
für den Einzug in das Berliner Parlament ebnete und auch auf dem Offenbacher
Parteitag zur Geltung kam.
Ebenso wie die lebhafte Rede- und Partizipationskultur in den
Reihen der Orangen, deren Konsequenzen auch Vorsitzende zu spüren bekommen.
Die Piraten sind - wie ehemals die Grünen - ein unbeschriebenes,
formbares Blatt.
Sie kennen (noch) keinen Personenkult. Einen Kult, den die SPD mit Helmut
Schmidt zelebriert. Sie wägen sich im Vorteil, als erste Partei auf die
Wichtigkeit des Internets im politischen Diskurs aufmerksam gemacht zu haben.
Das alles ist faktisch noch nichts, aber deutlich mehr als eine
Partei, die über ihre politische Identität mit einer neuen Farbe Antwort gibt.
„Gestaltungswillen" und "Selbstbewusstsein" solle
die neue Parteifarbe zum Ausdruck bringen, so Andrea Nahles auf dem Parteitag
der SPD. Aha.
(Bild: ZEIT Online)
Donnerstag, 1. Dezember 2011
Fernsehen. Na und?
Als ich
klein war, lief bei uns jeden Abend der Fernseher.
Für uns
Kinder war das ein gelungener Abschluss des Tages, konnten wir doch das
genießen, was uns nie überdrüssig erschien: Faulenzen und unterhalten werden.
Ich erinnere mich an lebendige Stunden voller Amüsement. Stunden, in denen wir Kinder später ins Bett gingen
als eigentlich vorgesehen. Stunden, in denen wir als Familie vor dem Fernseher
saßen und die Zeit als pochenden Schlag des Tages vergaßen. Das Fernsehen
schaffte als unterhaltendes Medium einen gemeinsamen Erfahrungsraum, den wir
teilten und formten.
Es gab Programmvorschläge,
Konsenssuchen. Ein nahezu ritualisiertes Neigungsszenario, das fast immer die
Mehrheit zufriedenstellen konnte. Auch, wenn diese aus einer Person bestand. Für meine Eltern
definierte sich das Fernsehen vor allem durch angenehm aufzunehmende Inhalte.
Die Öffentlich-Rechtlichen waren somit im Abendprogramm nur marginal auf der
Bildfläche vertreten. Spielten die Nachrichten bis 20.15 Uhr eine Rolle, so
verschwand der bildungsinformative Charakter des Ersten anschließend in den
Untiefen der Programmauswahl. Spielfilme
standen hoch im Kurs. Abendshows. Unlängst erreichten Wetten, dass? und die
Wok-WM Quotenhits in unserem Wohnzimmer. Sie schufen ein stilles Einvernehmen des
familiären Daseins.
Die Welt des
Fernsehens glich einem Raum, in dem es Glück, Schicksal, Freude und Leid gab. Probleme
und Gräueltaten platzierten sich seh- und hörbar im Gerät, existierten für mich aber nicht außerhalb. Und
obwohl ich die Grenze zwischen Fiktion und Realität spürte, war das, was im Fernsehen
lief, ein ferner, weitgezogener Brei.
Als ich
meine Mutter fragte, warum es in Israel Gewalt gebe, warum im mittleren Osten Krieg
herrsche, oder was Überhangmandate seien, stockten die Antworten. Das Ferne raunte
aus dem Bildschirm, die Sätze meiner Mutter lösten sich auf in bedecktes Schweigen.
Das, was das
Fernsehen übernahm, verloren meine Eltern. Und das, was meine Eltern übernehmen
sollten, vernachlässigte das Fernsehen. Doch es rüttelte nicht, es erzählte nicht,
es kratzte nicht an mir, weil ich nicht hinterfragte.
Wenn wir
abends zusammensaßen, war das Fernsehen unser aller Sprachorgan. Stimmen klangen
durch den Raum, vermittelten, diskutierten. Unser Diskurs schwieg indes.
Heute sind
nahezu alles Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren online. Vielleicht
diskutieren sie in Communities, auf Plattformen, in Foren. Vielleicht
informieren sie sich. Das wäre doch
etwas, um dem Schweigen in kleinen Schritten entgegenzutreten. Oder um zu
lernen, dass es draußen mehr gibt, als das Kollektiv im Haus.
Abonnieren
Posts (Atom)