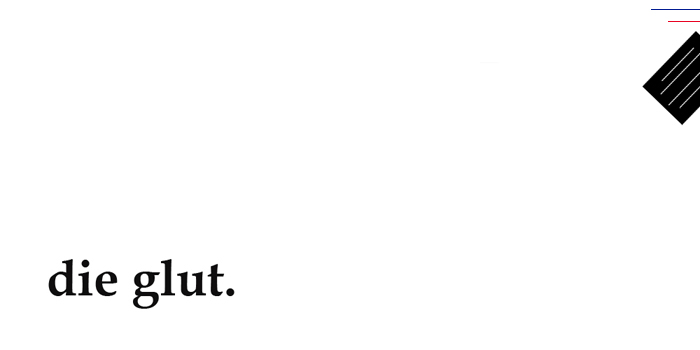Als ich mich sonntags im gut gefüllten IC nach einem freien Sitzplatz umschaue, lande ich im letzten Wagen des Intercitys von Hamburg nach Köln: Dem Fahrradwagon. Auf der Höhe von Osnabrück kommt es aufgrund eines Personenschadens zu einer unplanmäßigen Fahrtunterbrechung. So entwickelt sich mit meinem Sitznachbarn ein vorerst loses Gespräch über die Deutsche Bahn. Später berichtete mir der junge Mann, er heiße Pierre, sei Anfang zwanzig, wurde in Osnabrück geboren und habe sich für neun Jahre Bundeswehr verpflichtet. Momentan sei er in Aachen stationiert und absolviere eine Ausbildung zum Getriebetechniker. Und du, sagte er, studierst bestimmt.
Ich erinnere mich an Sherlock Holmes „Methode der Deduktion“ und an das Glück, eine richtig gute Menschenkenntnis zu besitzen. „Warum?“, frage ich schließlich. Pierre äußert: „Ich dachte es mir einfach.“ Er deutet auf die politische Zeitschrift neben mir, die ich während der Fahrt gelesen hatte. Eine einfache, vielleicht gefährliche Rechnung. Und doch eine völlig zutreffende, von Stereotypen geleitete Analyse seines Mitmenschen. Wir reden über seine Verpflichtung. „ Die kam einfach so. Beim Bund bist du fest im Sattel.“ Er wolle nicht ins Ausland, habe Angst vor Einsätzen in unbekanntem Gebiet. Pierre erzählt von Freunden, die in Afghanistan waren und traumatisiert nach Deutschland zurückkehrten. Die bekämen ihr Leben nicht mehr auf die Reihe, fügt er hinzu. Er spricht ruhig, ab und an fehlt ihm das Vokabular. Posttraumatische Entwicklungsstörung ist so ein Wort, das er meint, aber nicht auszusprechen vermag.
Später kommen wir auf mich zu sprechen. „Was studierst du?“, fragt Pierre. Ich berichte ihm von meinen Studienfächern, Pierre hakt nach: „Und was machst du da?“ Als ich von Inhalten erzähle, Theorien und Hausarbeiten, merke ich, dass Pierre nicht viel damit anfangen kann. Nicht, weil ihm das Interesse fehlt. Die Welt, die uns umgibt, das Vokabular und die Inhalte können unterschiedlicher nicht sein. Da ist sie also, diese Mittelschicht-Unterschicht-Causa, von der Özlem Topcu neulich schrieb. Ich selbst stamme aus einer Arbeiterfamilie und merke auf einmal diese emsig dünne Linie, die sich zwischen uns aufbäumt. Als wären Aufstieg und Abstieg zwei blinkende Warnleuchten.
Als ich den Zug verlasse, geht mir das Gespräch zwischen uns nicht mehr aus dem Kopf. Die einen haben Angst vorm Aufstieg, die anderen Angst vom dem Abstieg. Und allseits wuchern Wirtschaftsmoral und permanente Selbstmobilisierung. Vorurteile und Ansprachen im Imperativ.
Aber ein Gespräch miteinander? Auf Augenhöhe abseits des politischen Wahlkampfes oder postmoderner Standesdünkel? Das Gespräch mit Pierre und die Sensibilität, die wir füreinander gewonnen, die Achtung vor unsereiner Leben, haben, verdeutlichen mir: Stereotypen beiseiteschieben und reden. Es kann so ungemein befruchtend sein. Wir sollten endlich mehr wagen!