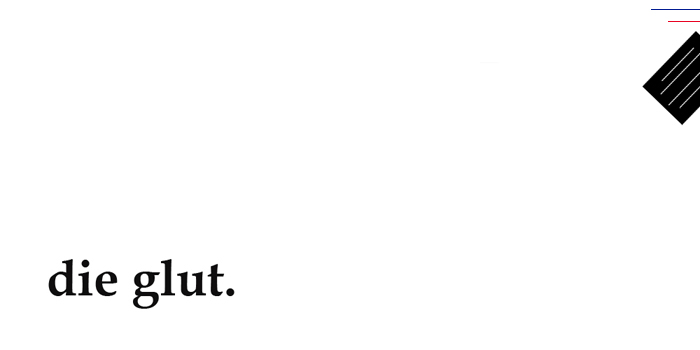Sonntag, 30. Dezember 2012
Mittwoch, 14. November 2012
Samstag, 29. September 2012
Das Gute im vermeintlich schlechten Leben
Als ich mich sonntags im gut gefüllten IC nach einem freien Sitzplatz umschaue, lande ich im letzten Wagen des Intercitys von Hamburg nach Köln: Dem Fahrradwagon. Auf der Höhe von Osnabrück kommt es aufgrund eines Personenschadens zu einer unplanmäßigen Fahrtunterbrechung. So entwickelt sich mit meinem Sitznachbarn ein vorerst loses Gespräch über die Deutsche Bahn. Später berichtete mir der junge Mann, er heiße Pierre, sei Anfang zwanzig, wurde in Osnabrück geboren und habe sich für neun Jahre Bundeswehr verpflichtet. Momentan sei er in Aachen stationiert und absolviere eine Ausbildung zum Getriebetechniker. Und du, sagte er, studierst bestimmt.
Ich erinnere mich an Sherlock Holmes „Methode der Deduktion“ und an das Glück, eine richtig gute Menschenkenntnis zu besitzen. „Warum?“, frage ich schließlich. Pierre äußert: „Ich dachte es mir einfach.“ Er deutet auf die politische Zeitschrift neben mir, die ich während der Fahrt gelesen hatte. Eine einfache, vielleicht gefährliche Rechnung. Und doch eine völlig zutreffende, von Stereotypen geleitete Analyse seines Mitmenschen. Wir reden über seine Verpflichtung. „ Die kam einfach so. Beim Bund bist du fest im Sattel.“ Er wolle nicht ins Ausland, habe Angst vor Einsätzen in unbekanntem Gebiet. Pierre erzählt von Freunden, die in Afghanistan waren und traumatisiert nach Deutschland zurückkehrten. Die bekämen ihr Leben nicht mehr auf die Reihe, fügt er hinzu. Er spricht ruhig, ab und an fehlt ihm das Vokabular. Posttraumatische Entwicklungsstörung ist so ein Wort, das er meint, aber nicht auszusprechen vermag.
Später kommen wir auf mich zu sprechen. „Was studierst du?“, fragt Pierre. Ich berichte ihm von meinen Studienfächern, Pierre hakt nach: „Und was machst du da?“ Als ich von Inhalten erzähle, Theorien und Hausarbeiten, merke ich, dass Pierre nicht viel damit anfangen kann. Nicht, weil ihm das Interesse fehlt. Die Welt, die uns umgibt, das Vokabular und die Inhalte können unterschiedlicher nicht sein. Da ist sie also, diese Mittelschicht-Unterschicht-Causa, von der Özlem Topcu neulich schrieb. Ich selbst stamme aus einer Arbeiterfamilie und merke auf einmal diese emsig dünne Linie, die sich zwischen uns aufbäumt. Als wären Aufstieg und Abstieg zwei blinkende Warnleuchten.
Als ich den Zug verlasse, geht mir das Gespräch zwischen uns nicht mehr aus dem Kopf. Die einen haben Angst vorm Aufstieg, die anderen Angst vom dem Abstieg. Und allseits wuchern Wirtschaftsmoral und permanente Selbstmobilisierung. Vorurteile und Ansprachen im Imperativ.
Aber ein Gespräch miteinander? Auf Augenhöhe abseits des politischen Wahlkampfes oder postmoderner Standesdünkel? Das Gespräch mit Pierre und die Sensibilität, die wir füreinander gewonnen, die Achtung vor unsereiner Leben, haben, verdeutlichen mir: Stereotypen beiseiteschieben und reden. Es kann so ungemein befruchtend sein. Wir sollten endlich mehr wagen!
Donnerstag, 10. Mai 2012
Donnerstag, 3. Mai 2012
Lieber grün und etabliert.
Ich bin Neumitglied der Grünen. Nicht der Piraten. Als junger Mensch mag
das für viele verwunderlich klingen. Denn oft höre ich, dass die
Piraten eine verführerische Alternative zu „etablierten“ Parteien
darstellen. Ich finde das nicht unbedingt.
In den späten 70er und frühen 80er Jahren haben die Grünen
sozialen Wandel und damit einhergehend die Veränderung des
gesellschaftlichen Wertebewusstseins vorangetrieben. Sie platzierten
sich als Alternative im etablierten Parteiengefüge und förderten somit
parteipolitischen Pluralismus. Sie taten damit unweigerlich das, was
viele heute den Piraten zuschreiben: Frischen Wind in zementierte
Politik bringen.
Im Gegensatz jedoch zu Grünen Anfangszeiten straucheln die Piraten thematisch auf zwei Weisen.
Dies liegt nicht an der groben politischen Richtung: Von ihrer netzpolitischen Agenda zum Thema Urheberrecht abgesehen, situieren sie sich mit wählerwirksamen Aussagen zum öffentlichen Nahverkehr und bildungsstrukturellen Veränderungen im linken Flügel.
Dies liegt nicht an der groben politischen Richtung: Von ihrer netzpolitischen Agenda zum Thema Urheberrecht abgesehen, situieren sie sich mit wählerwirksamen Aussagen zum öffentlichen Nahverkehr und bildungsstrukturellen Veränderungen im linken Flügel.
Problematisch ist die Tatsache, dass die Parteiprogrammatik
thematische Leerräume bildet. Leerräume, die aufgrund struktureller
Besonderheiten und fehlender Erfahrung und Kenntnissen entstehen und
sich von Erwartungen und Illusionen vieler Politikfrustrierter
sämtlicher Schichten nähren. Evidenzen sind hier die Wahlergebnisse in
Berlin und Saarland. In beiden Wahlkämpfen fehlten fundierte
Wahlprogramme. Der Einzug ins Landesparlament gelang trotzdem.
Dass gerade aber diese Leerräume erheblichen Anteil an einer
Zunahme politikverdrossener Bürger haben könnten, bleibt oft unerwähnt.
Denn trotz der Innovationskraft, welche die Piraten freilich innehaben, werden sie grundsätzliche Mechanismen des Politikbetriebes nicht über Bord werfen können. Vielmehr bedarf es Zeit sich an den konfliktbeladenen und konsensabhängigen Politikbetrieb zu gewöhnen. Dass für die Piraten hier strukturell Reformen notwendig sind, beweist ihr Verschleiß an Spitzenkräften.
Denn trotz der Innovationskraft, welche die Piraten freilich innehaben, werden sie grundsätzliche Mechanismen des Politikbetriebes nicht über Bord werfen können. Vielmehr bedarf es Zeit sich an den konfliktbeladenen und konsensabhängigen Politikbetrieb zu gewöhnen. Dass für die Piraten hier strukturell Reformen notwendig sind, beweist ihr Verschleiß an Spitzenkräften.
Problematisch ist zudem: Die Piraten werden ihrer symbolischen
Ausstrahlungskraft personell nicht gerecht. Dies liegt nicht an
fehlenden Kompetenzen, sondern fußt auf dem basisdemokratischen Prinzip
der Partei: Erst kollektiv diskutieren, dann öffentlich proklamieren.
Doch gerade im Wahlkampf stockt der so notwendige Wählerdialog.
Was sollen potentielle Wähler denken, wenn drei von vier Fragen mit der Antwort abgespeist werden: „Dazu kann ich noch nichts sagen.“ Für eine Partei, die sich gute Chancen auf einen Einzug in den Bundestag 2013 machen kann, ist das zu wenig.
Doch gerade im Wahlkampf stockt der so notwendige Wählerdialog.
Was sollen potentielle Wähler denken, wenn drei von vier Fragen mit der Antwort abgespeist werden: „Dazu kann ich noch nichts sagen.“ Für eine Partei, die sich gute Chancen auf einen Einzug in den Bundestag 2013 machen kann, ist das zu wenig.
Die Grünen sind etabliert. Sie verfügen über Delegierte, ein ausgereiften Parteiprogramm und erfahrene Spitzenkräfte. Die Piraten nicht.
Sie befinden sich im Werden. In Zukunft wird ihr Parteigesicht geschärft und aus thematischen Leerräumen, die gefüllt sind mit einer Vielzahl an Erwartungen, bildet sich ihr politisches Profil. Bis dahin bleibe ich eine Grüne. Und vielleicht darüber hinaus.
Dienstag, 17. April 2012
Montag, 16. April 2012
Dienstag, 10. April 2012
Mittwoch, 28. März 2012
Das Wir ist der Sieger.
„Wenn ich eine Zauberkugel hätte, würde ich sie nutzen“, sagte Joschka Fischer jüngst in einer Diskussionsrunde. „Denn ich weiß nicht, wie sich die Piraten entwickeln werden.“
Die Piraten.
Nach dem Wahlerfolg in Berlin ziehen sie nun ins saarländische Parlament ein. 7,6 Prozent
bringen ihnen vier Sitze, das sind mehr Sitze als Grüne und FDP zusammen vereinen können. Trotz des
Wahlerfolgs für CDU und SPD, die sich bereits vor der Wahl für eine große
Koalition ausgesprochen hatten, fokussiert sich der mediale Sturm auf die
Piratenpartei.
Einige
sprechen von einem Trend, der anhand der beiden Landtagswahlen zu erkennen sei:
Die Piraten werden ebenso bei den anstehenden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein
und Nordrhein-Westfalen ins Parlament kommen. Begründung: Sie treffen den Nerv
der Zeit.
Als sich die
Partei 2006 in Deutschland gründete, dachten SPD und Co nicht, dass jene (gern
firmierte) Protestpartei fünf Jahre später die Politiklandschaft durcheinander
rütteln würde. Heute spricht Andrea Nahles von einem Coolness-Faktor, welchen
die Piraten ausstrahlen und Bildungsministerin Schavan betont: „Wir wollen
verstehen (...) wie es die Piraten schaffen, Menschen zu überzeugen, die für
die etablierten Parteien verloren sind.“
Deutlich
wird: Die Piraten brechen die zementierte Politik, bedienen sich Lückenthemen,
sie entpersonalisieren das politische Tagesgeschehen. Nicht umsonst werben sie
auf Plakaten für den „Schwarmverstand.“ Sie rücken das Kollektiv in den
Vordergrund und zeigen: Hier gibt es politische Diskurse- abseits von
Hierarchien. Den Piraten geht es um politische Transparenz und Partizipation.
Demokratie soll gelebt, mitbestimmt werden. Liquid Democracy ist hier das
Stichwort.
Diese offene
und basisdemokratische Kommunikation macht die Attraktivität der Piraten aus.
Sie ausschließlich als Protestpartei zu verstehen, wäre falsch. Mag sie für
einige Wählerschichten als Protestpartei fungieren, definiert sie sich selbst
als Bürgerrechtspartei mit politisch-programmatischem Anspruch. Das spüren auch
die großen und kleinen Volksparteien. Über 8000 Nicht-WählerInnen machten ihr
Kreuz für die Piraten bei der Saarlandwahl, von CDU und SPD gingen knapp 7000
Stimmen an die netzaffine Partei.
Ob sich die
Piraten bei der Bundestagswahl 2013 auch
auf Bundesebene etablieren können, bleibt abzuwarten. Sicher ist, sie stehen
jetzt schon für einen Paradigmenwechsel in der Politik. Durch ihre
partizipierende Politik, ihr digitales Demokratieverständnis sowie die daraus
folgende Machtverschiebung machen sie die Teilhabe am demokratischen Prozess
für viele BürgerInnen schmackhaft. Das schmälern auch nicht die enge
thematische Ausrichtung auf der einen und die von FDP Politiker Döring
konstatierte „Tyrannei der Massen“ auf der anderen Seite.
Ob Christian
Lindners Präsenz den Wählerschwund der FDP in Nordrhein-Westfalen minimieren
kann? Dazu braucht es keine Zauberkugel.
Wenn die Piraten einen taktisch klugen Wahlkampf machen, dann schon. Es bleibt
dabei: Zuhören und Mitdenken- und dem Projekt
„digitale Demokratie“ beim Werden zusehen.
Sonntag, 25. März 2012
Mittwoch, 21. März 2012
Grün wider Willen.
Vor
wichtigen oder entscheidenden Wahlen ist die Stimmung parteipolitischer
Anhänger zuweilen aufgeladen, energetisch oder emotional. Schließlich
entscheidet sich an nur einem Tag, ob der monatelange Wahlkampf bei den
Wählerinnen und Wählern Anklang gefunden hat.
Nicht selten
resümieren Spitzenkandidaten dann „einen bitteren Tag“ (Steinmeier) oder sprechen
„von einem großartigen Erfolg“ (Westerwelle). Der Erfolg bemisst sich an
Wählerstimmen und Prozentzahlen.
Nicht selten
drängen jedoch parteiinterne wie externe Quälereien abseits des Wahlkampfes in
die Öffentlichkeit und werden dort mit offenen Armen aufgenommen.
Jüngst verbreitet
die Spitzenkandidaten-Debatte der Grünen heiße Kohlen im Medienfeuer. Parteichefin
Claudia Roth befeuerte die Spekulationen
um die Aufstellung eines Spitzenduos, in dem sie in der taz äußerte: "Ja,
ich stelle mich zur Wahl, wenn es um die Besetzung eines Spitzenteams für die
Grünen geht." Just danach rüffelte Trittin, dass jeder für sich wissen
müsse, ob solche Personalspekulationen zum jetzigen Zeitpunkt Sinn machten. Bums
– das saß.
Trittin, der
für viele Grünen eine nicht wegzudenkende Säule im Spitzengefüge darstellt,
weiß um die Wirkung einer öffentlich geführten Personaldebatte. Der FDP hat sie
einige Wählerstimmen gekostet. Der SPD (mit der Unterstützung des Altkanzlers
Schmidt) ausschließlich temporäre Publicity. Für die
Grünen könnte sie den Status einer progressiven, freundlichen, modernen Partei
nivellieren. Denn sie zeigt: Auch dort herrschen Machtkalküle, Taktiken und
Intrigen.
Dramatisch
ist zudem, dass Roth die Personaldebatte mit der Debatte über eine Frauenquote
vermischt. Im taz-Interview untermauerte sie: „Die Lösung,
dass ein einzelner Mann die Grünen im nächsten Bundestagswahlkampf anführt,
völlig unabhängig davon, wer das dann wäre, die wird es deshalb mit mir als
Parteichefin nicht geben. Die Quote gehört sozusagen zum grünen Grundgesetz.“
Die Spitzenkandidatur als Spitzenduo also. Postuliert in der
linken taz. Wäre man böse, würde man Claudia Roth unterstellen, sie würde ihre
personale Beliebtheit ausnutzen, um sich als Spitzenkandidatin (gerade im
Hinblick auf eine basisdemokratische Wahl) aufstellen zu lassen. Denn weder
Künast noch Löhrmann werden als bundespolitische Spitzen gehandelt. Die von
Roth betonte Quotenregelung ist also ein für die Parteichefin wohlschmeckender
Schmankerl. Schließlich, so munkelt man, könnte die kommende Bundestagswahl
2013 vielleicht die letzte sein, bei der Roth als Spitzenkandidatin antreten
würde.
Die Grünen wollen ihre stilisierte Rolle als gesellschaftliche
Vorreiterpartei stärken. Während Trittin als Spitzenkandidat gesetzt ist,
bleibt nun die Frage, welche Frau beste Chancen hat, die Spitzenkandidatur
nebst Trittin anzutreten. Eine breit geführte öffentliche Debatte
hinsichtlich grüner Personalpolitik anzustoßen, wäre fatal. Nicht zuletzt deshalb,
weil die allseits debattierte Quote auch nach Hinten losgehen kann: Wenn sich
die Basis für Trittin als Spitzenkandidaten ausspräche, gemäß seiner
Kompetenzen und Qualitäten, wäre die Quotenregelung überflüssig.
Denn schließlich würde dann eintreten, was Politiker samt
Entourage doch eigentlich wollen: Eine
Debatte um Kompetenzen, nicht um Geschlechter. Wenn die Grünen das merken, wären
sie vielleicht alsbald post-gender. Wie die Piraten.
Dienstag, 20. März 2012
Donnerstag, 8. März 2012
Der Zauberer von Berlin.
Der große Zapfenstreich naht. Trompeten und Worte im Garten des Schlosses Bellevue.
Schröder lauschte Sinatras „My Way“, Guttenberg zelebrierte seinen Abschied zu rockigen Deep Purple Klängen und Wulff, ja Wulff wünscht sich „Over the Rainbow“ – ein schläfrig schönes Lied, das zwischen paradiesischer Lautmalerei und gemäßigtem Tonus ein Moment des Träumens ermöglicht.
Wulffs Traumblase ist gefüllt mit Schlagzeilen. Hannelore Kraft und Frank-Walter Steinmeier rieten ihm auf den Zapfenstreich zu verzichten. Rund 160 Gäste haben ihre Teilnahme an dem Zapfenstreich abgesagt. Darunter zahlreiche Altbundespräsidenten sowie der designierte Bundespräsident Joachim Gauck. Mehr als die Hälfte des Parlamentes hat ihre Abwesenheit angekündigt. Wulffs Abschied wird in kleiner Runde stattfinden, es hat sich eine innenpolitische Allianz gegen den Ex-Bundespräsidenten eingeschworen.
Wulffs Zauber ist verflogen. Dem anfänglich in den Medien gehypten Glamour-Präsidentenpaar bleibt nebst umstrittenem Ehrensold ein Verfahren der Vorteilsannahme. Im politischen Gedächtnis ruht die Erinnerung, die Pressefreiheit massiv angekratzt haben zu wollen. Und sich selbst in seiner Abschiedsrede als tatkräftiger Präsident ohne Reue dargestellt zu haben.
Auf der Plattform Facebook mehren sich Stimmen, den Zapfenstreich zu stören. Aktivisten wollen die Zeremonie mit Vuvuzela-Klängen beeinträchtigen. Das muss nicht sein. Der feierliche Abschied als Hupkonzert und Vuvuzela-Protest?
Besser ein konstruktiver Diskurs über Ehrensold-Bestimmungen und politische Transparenz. Dann können politische Verantwortliche auch wieder träumen. Und zaubern.
Freitag, 13. Januar 2012
Freitag, 6. Januar 2012
Donnerstag, 5. Januar 2012
Ein Sack voller Möglichkeiten.
Zwischenzeitlich wird es laut im Raum. Mein Vater spricht von Möglichkeiten, ich aber wünsche mir, seine Gedankenfetzen in einen Karton packen zu können, ihn öffnungssicher in den Abstellraum zu hieven und vorerst nicht wieder zu öffnen. Möglichkeiten.
Mit einem guten Abitur hast du einige profitable Türen, die offen stehen, sagt er. Ich drehe mich um, schaue aus dem Fenster. Weiche seinen Augen aus. Oder vielleicht meiner Antwort auf eine Frage, die er nur indirekt gestellt hat.
Welcher Studiengang ist krisensicher? Welcher verspricht gute Jobchancen auf dem Arbeitsmarkt? Und mit welchem krebse ich nach meinem Studium nicht herum im Jobnirvana?
Zwei Jahre später studiere ich Soziologie und Medienwissenschaften. Die Studiengangwahl war eine Bauchentscheidung. Denken möchte ich im Studium. Nicht nur Vokabeln auswendig lernen oder Grammatik pauken. Ich beschäftige mich mit Foucault, Butler. Rundfunkanstalten oder Social Media. Langsam begreife ich die Komplexität des Seins, der Politik, der Wirtschaft. Und ich erkenne, dass mein Vater in Bezug auf meine Studiengangwahl rational argumentiert hat. Mit einem guten Abitur den besten Nutzen ziehen. Ökonomisch. Nicht jetzt, aber später.
Nach der Schulbildung hat mein Vater eine Ausbildung absolviert und bei einem großen Autohersteller Fuß gefasst. Seitdem arbeitet er dort. 25 Jahre, in denen er jeden Morgen um halb sechs aufsteht. Er hat trotz seines Hauptschulabschlusses eine gute Stelle bekommen und mit der Unterstützung meiner Mutter eine fünfköpfige Familie ernähren können. Vielleicht heißt sein Damoklesschwert Rationalität.
Mein Damoklesschwert indes ist die Ungewissheit. Es wird schwer für euch beruflich Fuß zu fassen, sagte mein Vater einmal. Ich weiß das. Noch unwohler wird mir allerdings bei dem Gedanken, vielleicht nicht für meine Eltern sorgen zu können, wenn sie ins Alter kommen. Ihnen nicht die Zeit zu geben, die sie mir während meines Studiums in unterschiedlichen Handlungen schenken.
Die Erhöhung des Renteneintrittsalters, das nun in Kraft getreten ist, stellt dabei einen Teil meiner Ungewissheit dar. Denn auf eine staatliche Rente werde ich mich nicht stützen können. Zu groß ist die Skepsis, mit 67 Jahren noch voll im Beruf zu stehen. Vor allem, weil der Druck, gesund, innovativ, fortschrittlich und effektiv sein zu müssen, schon heute den meisten meiner Kommilitonen schlaflose Nächte bereitet. Bloß nicht zu Zeitarbeitsfirmen. Bloß nicht vom Staat abhängig sein. Achte auf Referenzen. Achte auf deine Absicherung. Achte auf private Rücklagen. Es kursieren nicht nur private oder berufliche Anforderungen, sondern zudem das Bestreben, aus Selbstverwirklichung und Versorgung familiäre Verantwortung zu destillieren. Diese Ungewissheit verspürt die Wirtschaft per se nicht. Sie ist aber mein Begleiter. Ein unausgesprochener Gefährte, der mir begegnet, wenn Passion oder Effizienz meine Entscheidungen kreuzen.
Wenn mein Vater fragt, was ich später beruflich machen möchte, dann antworte ich häufig, etwas in den Medien. Vielleicht ist das zu wenig, irgendwann. Vielleicht sind die Möglichkeiten zu viel. Aber meine Hand werde ich ausstrecken. Der Ungewissheit sei Dank.
Abonnieren
Posts (Atom)