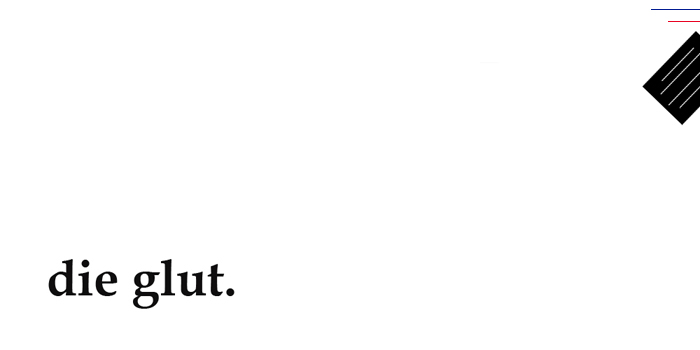Ich erinnere mich noch gut an den Eingang von Karstadt.
Von draußen kommend, ebneten weiße, schwere Türen den Weg in den
Zwischengang, der mich als Besucher an dekorierten Schaufenstern zum
eigentlichen Eingang schleuste. Die Schaufenster ließen mich ahnen, was der
modische Trend der für mich damals älteren Damen – jahreszeitenabhängig –sein mochte.
Häufig sind es lila bis brombeerfarbige Oberteile, an die ich mich erinnere. Versehen
mit schwarzen Applikationen, schimmerten sie durch die Glaswand. Die
Dekorationspuppen blickten ins Leere. Manchmal hatten sie keine Gesichter.
Als ich kleiner war, stellten die Eingangstüren eine
Herausforderung für mich dar. Weiß wie Krankenhaustüren waren sie. Zumeist musste
ich meinen ganzen Körper gegen das rechteckige Portal drücken, damit es aufging.
Ab und an hatte ich das Gefühl, dass meine Eltern mir halfen. Beweisen kann ich
es nicht. Karstadt war für mich ein Erlebnis. Zuallererst lief ich in die
Schreibwarenabteilung im Erdgeschoss. Der bekannte Geruch von Papier, Tinte, Radiergummis
und Bleistiften löste in mir ein Gefühl des Wohlseins aus. Karstadt beherbergte
alle Schätze, die mir zum damaligen Zeitpunkt wichtig erschienen. Während meine
Eltern in der Haushaltswarenabteilung stöberten, erkundete ich mit meinem
Bruder die Spielwaren in der ersten Etage. Ab und zu schlichen wir uns zu
faszinierend funkelnden Kristallen, deren Form sich in Schiffen, Blumen oder Tieren
zum Ausdruck brachte. Ich wollte immer eines besitzen, am liebsten ein kleines
Schiff, das ich in mein Regal gestellt hätte.
Zu Karneval erfreute ich mich an der für die Jecken hergerichteten
Abteilung. Überall lagen Masken, Schwerter, Kostüme. Sowieso waren anstehende
Festakte das Highlight. Ich tauchte ein in die Atmosphäre kürzlich anstehender
Feste, vergaß Pflichten und übersah an manchen Tagen die Realität. Ich teilte
mit meinem Bruder die Freude zum Erkunden, wir ließen unsere Finger gleiten
über Plastik, Stoff und Filz. Fuhren Rolltreppen nach oben, nach unten. Wir
träumten. Wir träumten nicht von materialisierten Dingen. Auch, wenn ab und an
Tränen wegen etwas Dortgebliebenem rollten. Wir träumten von Geschichten,
Ereignissen. Nahmen Bären mit auf die Reise, Skateboards, kleine Tiere aus
Plastik, die den Weg vorgaben. Wir verkörperten das, was man im Nachhinein als
Unbekümmertheit bezeichnet.
Als ich älter wurde und mit meinen Freundinnen in größere Städte fahren
durfte, verließ mich der Reiz von Karstadt. Ich erkannte, dass es eigene, für
sich stehende Markengeschäfte gab. Meine Wahrnehmung dezentralisierte sich.
Eigens erfundene Geschichten, die ich mit meinem Bruder immer wieder erlebte,
verflachten, bis sie schließlich ganz aufhörten und nur in Erinnerungen
auflebten.
Als ich letztens zu Karstadt ging, kam es wieder. Das Gefühl des
Bekannten. Der Geruch von Schreibwarenartikel, der Wunsch noch einmal Klein zu
sein.
Denn wenn ich jetzt an Karstadt denke, dem Prunkstück der BRD, fällt
mir Marc Augé ein, sein Begriff der Nicht-Orte, Insolvenz, Stellenabbau. Es
fällt mir schwer, Geschichten zu spannen, in denen nicht die Realität Platz
findet. Denn die Realität hat mich so ummantelt, dass ich, wenn ich meine Augen
schließe, weiß: Karstadt gibt es für viele Junge nicht mehr.