Als ich
klein war, lief bei uns jeden Abend der Fernseher.
Für uns
Kinder war das ein gelungener Abschluss des Tages, konnten wir doch das
genießen, was uns nie überdrüssig erschien: Faulenzen und unterhalten werden.
Ich erinnere mich an lebendige Stunden voller Amüsement. Stunden, in denen wir Kinder später ins Bett gingen
als eigentlich vorgesehen. Stunden, in denen wir als Familie vor dem Fernseher
saßen und die Zeit als pochenden Schlag des Tages vergaßen. Das Fernsehen
schaffte als unterhaltendes Medium einen gemeinsamen Erfahrungsraum, den wir
teilten und formten.
Es gab Programmvorschläge,
Konsenssuchen. Ein nahezu ritualisiertes Neigungsszenario, das fast immer die
Mehrheit zufriedenstellen konnte. Auch, wenn diese aus einer Person bestand. Für meine Eltern
definierte sich das Fernsehen vor allem durch angenehm aufzunehmende Inhalte.
Die Öffentlich-Rechtlichen waren somit im Abendprogramm nur marginal auf der
Bildfläche vertreten. Spielten die Nachrichten bis 20.15 Uhr eine Rolle, so
verschwand der bildungsinformative Charakter des Ersten anschließend in den
Untiefen der Programmauswahl. Spielfilme
standen hoch im Kurs. Abendshows. Unlängst erreichten Wetten, dass? und die
Wok-WM Quotenhits in unserem Wohnzimmer. Sie schufen ein stilles Einvernehmen des
familiären Daseins.
Die Welt des
Fernsehens glich einem Raum, in dem es Glück, Schicksal, Freude und Leid gab. Probleme
und Gräueltaten platzierten sich seh- und hörbar im Gerät, existierten für mich aber nicht außerhalb. Und
obwohl ich die Grenze zwischen Fiktion und Realität spürte, war das, was im Fernsehen
lief, ein ferner, weitgezogener Brei.
Als ich
meine Mutter fragte, warum es in Israel Gewalt gebe, warum im mittleren Osten Krieg
herrsche, oder was Überhangmandate seien, stockten die Antworten. Das Ferne raunte
aus dem Bildschirm, die Sätze meiner Mutter lösten sich auf in bedecktes Schweigen.
Das, was das
Fernsehen übernahm, verloren meine Eltern. Und das, was meine Eltern übernehmen
sollten, vernachlässigte das Fernsehen. Doch es rüttelte nicht, es erzählte nicht,
es kratzte nicht an mir, weil ich nicht hinterfragte.
Wenn wir
abends zusammensaßen, war das Fernsehen unser aller Sprachorgan. Stimmen klangen
durch den Raum, vermittelten, diskutierten. Unser Diskurs schwieg indes.
Heute sind
nahezu alles Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren online. Vielleicht
diskutieren sie in Communities, auf Plattformen, in Foren. Vielleicht
informieren sie sich. Das wäre doch
etwas, um dem Schweigen in kleinen Schritten entgegenzutreten. Oder um zu
lernen, dass es draußen mehr gibt, als das Kollektiv im Haus.
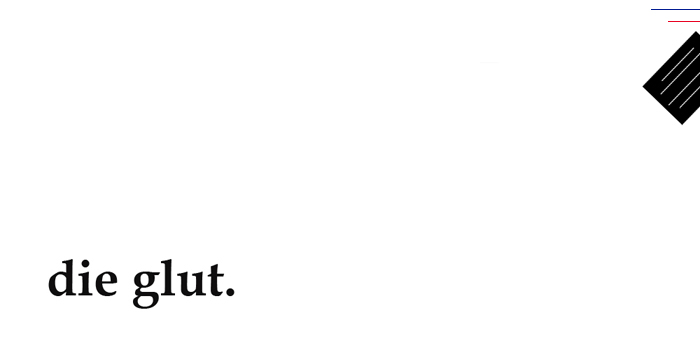
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen