Wenn ich am
späten Sonntag durch den zuckenden Tatort-Abspann aufgerüttelt werde, ertönt in
meinem Kopf die Stimme meiner Oma. „Die Christiansen, die kannste dir anschauen“,
sagte sie einmal zu mir. Hätte sie gewusst, dass seit diesem Herbst im
öffentlich-rechtlichen Rundfunk nahezu jeden Abend politisch getalkt wird, wäre
sie ungläubig mit dem Kommentar: „Und wer schaut sich das an?“ aus dem Raum
gegangen.
Günter Jauch
verzeichnete bei seiner ersten Sendung 5,1 Millionen Zuschauer. Anne Will, die sonntags
im Durchschnitt 4 Millionen Menschen vor den Fernseher lockte, muss sich fortan
mit dem weniger attraktiven Sendeplatz am Mittwochabend begnügen.
Nebst Jauch
und Will tummeln sich Plasberg, Maischberger und Beckmann im Talkprogramm der
ARD. Kritische Stimmen fragten bereit unmittelbar nach der Bekanntgabe des
Konzepts, wie die Gästeattraktivität aufrecht erhalten werden solle. Schließlich
bewandern Hans-Ulrich Jörges, Klaus Kocks oder Richard-David Precht regelmäßig die
Gehwege der Talkshowrunden. Kocks gab im
Tagesspiegel just lakonisch zu, er wäre bereits so häufig in Talkshows gewesen,
dass die Gäste das Gefühl bekämen, er
sei einfach sitzengeblieben. Ein Koordinationsbüro der ARD übernimmt nun die
Aufgabe, für Ausgewogenheit der Gäste zu sorgen. Schließlich geht es nicht
darum, intern Reibereien qua Gästeunstimmigkeiten auszulösen, nur weil die ARD
Programmdirektoren eine einheitliche Sendezeit der Tagesthemen anstrebten und
somit den Talkrhythmus neu zusammenwürfelten.
Sandra
Maischberger sagte zu Peter Kümmel in der ZEIT, die Diskussionsrunden seien in
einer Mitte angekommen. Eine Mitte, in der Inszenierung, Dramaturgie und Kalkül
der Teilnehmer mehr gewichten als die eigentliche Zielsetzung des
Erkenntnisgewinns für den Zuschauer.
In ihr herrscht
Homogenität. Quotenfixierung. Und eine sonderbare Melange aus Phrasen, Behäbig-
und interessengeleiteter Eitelkeit.
Diskussionsteilnehmer
machen es den Moderatoren schwer, erquickende und spontane Momente aus den
Beteiligten heraus zu kitzeln. Wenn Politiker sprechen, weiß man: Es gibt mehr
Unausgesprochenes als Gesprochenes. Und wenn Gysi eingeladen wird, spürt der
Zuschauer: Er ist der Hebel, der den Kauderwelsch aufbrechen soll.
Wie im
Printbereich verzeichnet sich in den Shows die Tendenz, einen Titel mit Nutzwert
für den Rezipienten zu generieren. Jauch
thematisiert „Generation doof“, Plasberg fragt: „Gehören Pummel an den Pranger?“,
Will sinnt über „Internet-Mobbing“ und Maischberger diskutiert „Ticks, Panik,
Phobien“. Je emotionaler das Thema, desto eher der Identifikationsgrad. Und
desto eher die Chance, dass der Zuschauer einschaltet. Der Gefahr, dass sich
die Talkshowrunden in ein homogenes Feld einbetten, eingeschlossen.
Wie sehr
wünscht man sich in diesem Gewühl aus Talkshowbrei Querdenker und konstruktive Querulanten?
Diskutierende Intellektuelle in einer intimen Runde. Dieses kaum greifbare
Gefühl einer schöpferischen Runde.
Es stellen
sich allerlei Fragen: Verschreckt die
Anzahl der Talkangebote den Zuschauer? Vermindert jene die Qualität des
politischen Talks? Wie wirkt der Grundversorgungsauftrag der ARD ein? Und welches Talkshowformat ist kompatibel
mit Massenmedien?
Wenn ich
nach der Theorie meiner Oma gehen würde, wäre der Sonntagabend ohne meine
Beteiligung. Und doch ertappe ich mich dabei, nach dem Tatort zumindest die Vorstellung
der Talkgäste abzuwarten. Denn wie sagte Goethe: „Der Widerspruch ist es, der
uns produktiv macht.“
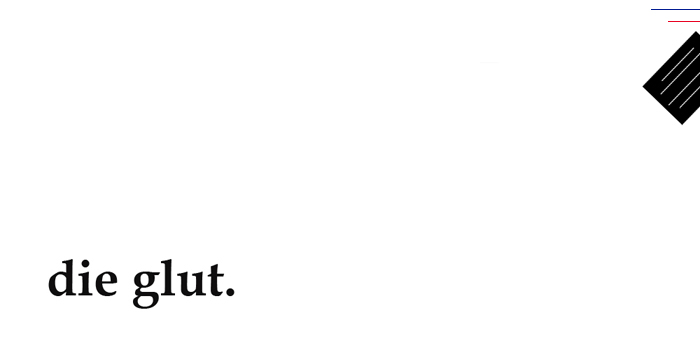
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen